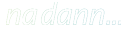Von , 01.04.2020
Corona Corner KW 14
Grüße von der Insel
(mex) Eigentlich ist es ja gar keine richtige Insel, hier wo ich wohne. „Rote Insel“ nennt sich die Gegend im Bezirk Schöneberg. Rot, weil die Anwohner hier traditionell eher „links“ orientiert sind und sich beispielsweise die SPD seit dem Ende des 19. Jahrhunderts in diesem Siedlungsgebiet sogenannter „kleinen Leute“ einen überproportional hohen Stimmenanteil sichern konnte. Und Insel? Tja, die Lage macht’s. Trotz Abwesenheit unüberwindbaren Wassers, macht sich doch eindeutig ein gewisses Isolationsfeeling breit. Eingequetscht zwischen S-, Eisenbahnlinien und Hauptstraßen hat sich ein fast abgeschlossenes Viertel entwickelt, das eigentlich nur für Anwohner interessant ist.
Ein von Touristen praktisch unentdecktes Kleinod im Stadtplan der überwiegend aufgeregten Hauptstadt. Allerdings verbergen sich auch hier, in den fünf bis sechs Straßen der Nachbarschaft, einige nennenswerte Attraktionen. Hildegard Knef hat hier gelebt, direkt nebenan. Und keine 200 Meter weiter die Straße hinab befindet sich das Geburtshaus Marlene Dietrichs. Julius Leber traf in der Torgauer Straße Gleichgesinnte aus dem Widerstand gegen die Nazis. Der Ort, eine ehemalige Kohlenhandlung, ist noch heute zu besichtigen. Auch Alfred Lion Gründer des legendären Labels „Blue Note Records“, von dem hier später auch noch die Rede sein wird, stammt von hier. An ihn erinnert eine kleine Brücke, über die man die Insel dann in die große weite Welt verlassen kann.
Das waren noch Zeiten, als man noch spielerisch Überlegungen anstellte, was man wohl mitnähme, würde man eine längere Zeit alleine auf einer Insel verbringen müssen. Getrennt von allen Sozialkontakten, rausgerissen aus täglicher Routine, weit weg von der Aussicht auf das rettende Ufer des Festlandes. So richtig ausgemalt hat man sich diese Art von Situation eigentlich nie. Vielmehr galt die Prämisse der Isolation eher als Ausgangspunk dafür, darüber nachzudenken, was wirklich unentbehrlich ist im Alltag, welchen Verzicht man sich möglichst niemals würde zumuten wollen. Kurz: Was ist wichtig im Leben und was muss mit?
Das Achterpack Toilettenpapier stand da bei den meisten wohl ebenso wenige auf der Liste, wie 10 x 42 Gramm frische Hefe oder hässliche Masken der Güteklasse FFP3. Nein, bei der Frage der Inselrelevanz ging es eher um die wirklich schönen Dinge, vornehmlich um Musikaufnahmen und Bücher. Und so wurde beispielsweise das Prädikat „Inselplatte“ zum Gütesiegel der Enthusiasten, zur Aufforderung an Alle, es mit dem empfohlenen Tonträger doch einmal zu versuchen.
Ein realer Aufenthalt auf einem kleinen Eiland mit Palme, Wrackteilen eines Rettungsbootes am Bilderbuchstrand und ungehinderte Aussicht auf endlose See wurde niemals ernsthaft mitgedacht, die imaginäre Inselsituation fungierte stets als gutmütige Metapher und inspirierender Auftakt für eine amüsante Spielerei. Nun, Insel war gestern. Die eigenen vier Wände das neue Heute. Hätte man nicht gedacht. Isoliert daheim. Allein, mit sich, mit Partner*in, WG-Mit be-wohner*in, Familie, Oma und Opa, Kind und Kegel ... Was also tun rund um die Uhr. Wie könnte sie aussehen, die neue Struktur des Alltages? Saubermachen, Entrümpeln, Anträge suchen und ausfüllen, ... jaja, ist klar. Und sonst? Wie wäre es denn also mit der Konkretisierung der „Insellisten“?
 Für die Inselliste: McCoy Tyner – The Real McCoy, Blue Note Records
Für die Inselliste: McCoy Tyner – The Real McCoy, Blue Note Records
Kein Problem, hinein ins Vergnügen: Als am 6. März der amerikanische Musiker Mc-Coy Tyner starb, trauerte die Musikwelt um einen der einflussreichsten Pianisten des modernen Jazz. 81 Jahre ist er alt geworden. Fast unglaubliche 60 Jahre ist es her, dass Tyner mit John Coltrane, Jimmy Garrison und Elvin Jones mit dazu beigetragen hat, den Jazz neu zu definieren. Im Übrigen mit nicht unerheblichen Auswirkungen auf Rock- und Popmusik. Als Coltrane sich Mitte der 60er Jahre immer weiter in freiere musikalische Gefilde vertiefte, endete die spektakuläre Zusammenarbeit. McCoy, noch keine 30, entwickelte seine eigenen musikalischen Ideen, als Improvisator, Komponist und Bandleader. Am 21. April 1967 begab sich McCoy Tyner in Rudy van Gelders legendäres Ton-studio auf der anderen Seite des Hudson Rivers und nahm seine erste eigene Platte für das Label Blue Note (remember? Alfred Lion) auf. Damals an seiner Seite: Der Saxo-phonist Joe Henderson, gerade selbst auf dem Sprung in eine neue künstlerische Phase, Bassist Ron Carter, aktuelles Mitglied des epochalen Miles Davis Quintetts und Schlagzeuger Elvin Jones, der Kollege aus der Coltranezeit, mit dem es Tyner gelungen war, aus achtundachtzig Tasten und einer gehörigen Anzahl Becken und Felle ein ein-ziges großes, perfekt synchronisiertes Ins-trument zu bilden. Das Resultat dieses 53 Jahre zurückliegenden Frühlingstages: „McCoy Tyner: The Real McCoy / Blue Note Records“. 5 Songs, 5 Evergreens – ein ewiger Fixpunkt im Firmament des Jazz. Der wahre Jakob. Hört doch mal rein. In einer Zeit wie diese und in allen anderen.
 Kino in Zeiten der Krise
Kino in Zeiten der Krise
Apropos „die wirklich schönen Dinge des Lebens“. Was ist eigentlich mit Kino? Zu ist. Kein Programm, keine Kritiken, kein Popcorn? Ok, zumindest das Popkornproblem scheint in Münster durch den @home-Lieferservice der Firma Cineplex gelöst. Aber ansonsten nur Netflix, Amazon, Youtube? Aber nein, ein kleiner Verein kinobegeisterter Menschen in Berlin kämpft aufrecht für die Verfügbarkeit des alternativen Films. Das „Arsenal – Institut für Film- und Videokunst e.V.“ ist beheimatet im Sony-Center am Potsdamer Platz. Monat für Monat präsentiert es dem interessierten Publikum ein attraktives Programm erlesener Filmkunst. Mit der Schließung der Kinos war es das dann erst einmal. Doch nun geht der Verein online. Mit dem Einverständnis aller involvierter Filmemacher*innen setzt das Arsenal sein Programm fort. Kostenlos im Netz. Unter www.arsenal-berlin.de haben wir alle die Wahl aus einem bunten Strauß außergewöhnlicher Filme ein wenig Abwechslung in unseren Bildschirmalltag zu bringen.
na dann..., bleibt gesund.
Manfred Wex, langjähriges Mitglied im Team na dann ...
----------------------------------------------------------------------
Unruhige Stille
 "Die erschöpfte Gesellschaft kommt zum Atmen, auch wenn es unter der grauen Glocke der Ungewissheit stattfindet. Merkwürdig, wie Zeit sich aus- dehnt und gleichzeitig fliegt."
"Die erschöpfte Gesellschaft kommt zum Atmen, auch wenn es unter der grauen Glocke der Ungewissheit stattfindet. Merkwürdig, wie Zeit sich aus- dehnt und gleichzeitig fliegt."
Der Zentralfriedhof gehörte schon immer zu meinen Lieblingsorten. Am Tag 4 der „Kontaktsperre“ legt sich auf die tiefe sichere Ruhe, die der Ort für mich immer ausstrahlte, eine unbekannte unruhige Stille. Hunderte von gelben und lila Stiefmütterchen warten auf die Friedhofsgärtner, der Schmetterling entfaltet sich in der Sonne. Mitten in der Pandemie die Schönheit des Frühlings ohne die unbeschwerte Vorfreude.
Am Wochenende vor der offiziellen Kontaktsperre, als wir zum Schutz der Gesellschaft die Distanz schon gut trainiert hatten, hieß es am Blumenstand ganz unverblümt: „Die Alten sind immer schon gestorben, dann ist es jetzt auch wieder so.“ Meine Sprachlosigkeit war eine innere laute Stille. Wie jetzt die richtigen Worte finden, wenn es um so zentrale ethische Fragen geht: Wie gelingt es, gleichzeitig Menschen zu schützen, die ein höheres Risiko haben zu sterben, das Gesundheitssystem vorzubereiten und dabei gesellschaftlich stabil zu bleiben? Ich laufe doch in die Argumentationsfalle und verweise auf die jungen Menschen: „Wissen Sie auch, dass in Deutschland jeder Fünfte chronisch krank ist oder eine Erkrankung hat? Auch Kinder und Jugendliche haben Rheuma, Diabetes, Asthma, Autoimmunerkrankungen, kennen Sie denn keinen Krebskranken oder behinderten Menschen?“
Vor der Lambertikirche sitzt kein Bettler, ich trete ein und finde mich plötzlich in einer komplett menschenleeren Kirche. Es brennen nur wenige Kerzen vor der Statue des lächelnden Antonius und vor dem Marienbild. An diesem normalerweisen wohltuend leisen Ort rumoren in die Leere hinein Gedanken, Bilder, Fragen. Schließlich kommen zwei Tontechniker aus der Sakristei, wohl um die Kirche virtuell vorzubereiten.
Gut drei Wochen liegen zurück, als Hunderte im Rathausfestsaal während der VHS-Veranstaltung über „Sterben in Würde“ und die Palliativmedizin diskutierten. Jetzt transportieren Lastwagen in Italien die Leichen. Sterben ohne einen liebenden Angehörigen, ohne gemeinsamen Abschied? Werden wir die Würde bewahren können?
An der Litfaßsäule lächelt der Gauloises-Mann noch immer über dem Slogan „Und die Welt steht still.“ In unserer gemeinsamen Lernkurve zur Pandemie musste der erhabene Moment des Selbstvergessens in ein angespanntes Innehalten umgedeutet werden. Aus der Isolation heraus ist unsere Stadtgesellschaft schnell aktiv geworden – Hilfsangebote überall, soziale Nähe in der Nachbarschaft, für die Krankenhäuser, für sozial Schwächere, im Engagement für die Freischaffenden und Künstler.
Es ist ja kaum zwei Wochen her, dass wir auf dem Weg zu Tugsal Moguls Premiere „Deutsche Ärzte Grenzenlos“ im Theater waren. Aufgrund der Corona-Infektionen im Theater wurde glücklicherweise schnell entschieden, die Vorstellungen abzusagen. Statt des Blicks in den Mediziner-Alltag auf der Bühne, führt jetzt der Corona-News-Ticker in das Gesundheits- und Krankenhaussystem. Als würden wir die unmenschlichen Folgen der Ökonomisierung des Gesundheitswesens nicht schon seit Jahren beklagen. Glücklicherweise strömt den Pfleger innen und Pflegern, den Ärzten, Physiotherapeuten und dem Personal in den Pflegeheimen eine Welle der Dankbarkeit und Wertschätzung entgegen.
Jäh aus der hohen Schlagzahl des gehetzten Alltags gerissen, ist es erstaunlich, wie gelassen sich fast alle in den räumlichen Rückzug begeben haben. Abends geht ringsum in den Wohnungen früh das Licht aus. Die erschöpfte Gesellschaft kommt zum Atmen, auch wenn es unter der grauen Glocke der Ungewissheit stattfindet. Merkwürdig, wie Zeit sich ausdehnt und gleichzeitig fliegt.
Welche Freude, wenn es in manchen Ge-sprächen unter Freundinnen und Freunden so gut gelingt, von der Zukunft her zu denken: Was wollen wir als Gesellschaft, wofür ste-hen wir, wie viel bedeuten uns die Schwachen, die Armen, die am Rande? Wenn wir uns jetzt die Welt im Jahr 2022 anschauen, wie blicken wir aus dieser Vision auf das Heute? Gute Krisenkommunikation entwickelt Worst-Case-Szenarien, damit Handeln an die Stelle von Angst tritt.
Die Chancen der Krise zu beleuchten lässt durch die eigenen vier Wände die Gemeinschaft spüren. Daneben lauert die Ungewissheit: Was kommt auf uns zu im besten, was im schlechtesten Fall? Ist dies die Ruhe vor dem Sturm? Können wir die tiefe wirtschaftliche Rezession vermeiden? Wie geht es den Familien gerade, zu denen die Jugend ämter gerade nicht gehen; wie geht es den Kin dern, die in Kitas und Schulen mit Frühstück und frischer Kleidung, mit Zuwendung und Struktur aufgefangen wurden? Wie geht es weiter mit flüchtenden Menschen?
Wie können wir mit allen gemeinsam die Wirtschaftskraft erhalten – auch um uns ein gutes Gesundheitssystem leisten zu können.
Ich versuche mir zu vergegenwärtigen, wie sich die Zeit nach Tschernobyl 1986 anfühlte. Ich frage mich das, weil ich soviel an die jungen Menschen denken muss, die jetzt gerade ins Leben starten. Einladungen zu ihren Vorstellungsgesprächen werden gecancelt, Kurzarbeit wird zum kleineren Übel, das Abi ist verschoben. Im Jahr 1986 hat es am Honig, wie ich ihn gerade aus den Baumbergen mitgebracht habe, keine Freude gegeben. Halbwertzeit.
Als der Reaktor in Tschernobyl explodierte, war ich kurz vor meinem 26. Geburtstag. Ich war politisch, habe demonstriert, war engagiert und hoffte immer, das Beste für die Gesellschaft zu tun. Bis mich im letzten Jahr meine jungen Neffen fragten, als ich ihnen zurief, sich noch stärker zu engagieren: Aber du bist doch die Generation, die uns diese Gesellschaft hinterlassen hat. Und nun, mitten in der Krise, welche Konflikte gilt es zwischen den Generationen zu lösen?
Werden wir jetzt als Gesellschaft, die 60 Jahre lang in Frieden und großem Wohlstand gelebt hat, diese Krise meistern, überwinden und dann die Welt zu einem noch besseren Ort machen? Nicht nur in Münster, in Deutschland, auch in Afrika und im Nahen Osten? Werde ich weiter am Aasee müde belächelt von den jugendlichen Paaren, wenn ich versuche, Abstand zu halten? Oder wird das Training die Tugend der Höflichkeit, egal welchen Alters, neu beleben und uns allen Druck machen, unsere Werte zu definieren und zu diesen Werten zu stehen. Der Blick auf die Welt ist in diesen Zeiten ist immer ambivalent, so wie der sonnige Frühling gleichzeitig die Ruhe vor dem Sturm des Virus sein kann. Hoffen wir gemeinsam, dass die Pandemie nicht so zerstörerisch wirkt auf unserer Welt, so dass wir eine gute Zukunft gemeinsam und in Freiheit gestalten können.
Christa Farwick, Kommunikationsberaterin, Autorin „Das Münsterbuch. Der Stadtführer“
----------------------------------------------------------------------
Lang nicht mehr …
Eine weitere Woche liegt hinter uns, es ist Freitag Vormittag und ich sitze im ruhigen Haus mit drei Mädchen. Diese Woche stand unter dem Motto „Lang nicht mehr …“. Es ist faszinierend, wie sich das Zusammenleben mit den Mädchen, meine Stimmung und das Aktivitätenlevel verändert haben in dieser Zeit. Ich habe meine Kinder befragt, wie sie mit dieser außergewöhnlichen Zeit zurecht kommen, was ihnen gefällt und ob ihnen was fehlt.
Lange habe ich nicht mehr eine der Zwillingsmädchen ins fünf Kilometer entfernte Nachbardorf zu Verabredungen gefahren. Sie gehen dort zur Schule, ihre Freunde wohnen folglich alle dort und sonst fahre ich an zwei bis drei Nachmittagen die Woche die Mädels zu ihren Treffen und hole sie später wieder ab. Den Zwillingen fehlen ihre Klasse und Freunde und sie schreiben öfter wieder per Handy hin und her. Auch die Große vermisst ihre Freundinnen, mehr noch Oma und Opa und auch ihr Handballtraining fällt ihr ein.
Der fehlende Kontakt zu ihren Klassenkameraden ist das einzige, was den Mädchen fehlt. Die Schule an sich fehlt den Kindern nicht. Im Gegenteil, sie antworten unisono auf die Frage, was ihnen generell am Zuhausesein schön finden, dass es Spaß macht, die Aufgaben zu Hause zu erledigen und ausschließlich Zuhause zu lernen. Die freie Einteilung der Zeit für die Aufgaben heben sie alle hevor und dies bestätigt meinen Eindruck der letzter Woche. Die Stimmung bei den Hausaufgaben empfindet ein Mädchen auch als sehr ruhig und gut. Der Druck ist von den Kindern genommen, sie können sich ihre Zeit selbst einteilen und auch mal nur Deutsch im Voraus machen, wenn sie Lust haben. Dieses gelingt ihnen sehr gut ein und sie haben noch nie so druckbefreit ihre Aufgaben erledigt.
Die Zeit so eng und intensiv miteinander schweißt uns sehr zusammen. Den Mädchen ist auch aufgefallen, dass es Streitereien nur noch selten gibt. Der Respekt vor den Wünschen und den Gefühlen des Gegenübers hat sehr zugenommen. Wir vier bilden eine harmonische Einheit. Eines der Mädchen bemerkte gar, dass unsere Stimmen jetzt so leise und ruhig geworden sind, was ihr sehr gefällt.
 Es gab Spaghetti Bolognese (die beiden linken Köchinnen) und Schoko-Bananen- kuchen (rechtes Mädchen)
Es gab Spaghetti Bolognese (die beiden linken Köchinnen) und Schoko-Bananen- kuchen (rechtes Mädchen)
Die Große hat schul- und freizeitbedingt lange nicht mehr die Zeit gefunden für uns zu kochen, was sie an sich sehr genießt und gerne macht. Diese Woche hat sie mit ihren Schwestern einen Essensplan zusammengestellt und ich werde jeden Tag bekocht. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass sie von sich aus Aufgaben übernehmen, die ihnen gefallen.
Durch die fehlenden Termine haben die Kinder sehr viel Zeit. Neben den täglichen Zeiten im Garten, wo sie sich einen Parcours aufbauen oder in der Hängematte liegen, haben sie das Lesen für sich neu entdeckt und finden es auf einmal sehr cool. Harry Potter steht hier hoch im Kurs. Die Zwillinge haben gestern sechs bzw. sieben Stunden gelesen. Mich erstaunt es, mit welcher Freude sie dies tun. Die Große hat den Freiluftsport neu für sich entdeckt und zieht auf Inlinern ihre Runden durch’s Viertel. Für die nächste Zeit wünschen sie sich auch nichts mehr als gutes Wetter, um weiterhin ihren neuen Hobbies nachgehen zu können und dass alles gut wird.
Die Kleiderordnung reißt hier zusehends ein. Dadurch, dass wir 99 % der Zeit Zuhause verbringen, sind bequeme Sachen an der Tagesordnung. Auch bei mir macht sich die Bequemlichkeit breit und ich verbringe die meisten Tage in gemütlichen Sachen. Selbst das Föhnen und Schminken spare ich mir, mich sieht ja doch niemand und die Natürlichkeit gefällt mir zusehends. Die Mädchen kommen aus ihren Schlafanzügen kaum noch raus. Zwilling 2 hat sogar festgestellt, dass es besser ist, keine Unterwäsche unter dem Schlafi zu tragen, denn die muss man ja jeden Tag wechseln … wir haben lange nicht mehr über Körperhygiene gesprochen, scheint mir :)
Nachdem wir letzte Woche den Garten hinter dem Haus auf Vordermann gebracht haben, war diese Woche der Vorgarten dran. Nach dem Winterschlaf ist das Unkraut erwacht und ich habe lange nicht mehr die Größe des Vordergartens so verflucht. Auch die Fenster haben eine Wäsche hinter sich. Meine Kinder haben die Fenster in ihren Zimmern alleine geputzt. Sie sind erstaunlich sauber geworden. Der ungetrübte Blick ins so freundliche und sonnige Draußen ist erfrischend. Wir konnten lange nicht mehr so früh erkennen, wer auf der Auffahrt zu uns läuft :)
Wir haben uns an diese Isolation Zuhause gewöhnt und das Leben ist momentan gut zu uns. Während sich mein Leben verlangsamt und intensiviert, denke ich so oft wie noch nie an all die Menschen, zu denen das Leben momentan nicht so gut ist. Ich werde dadurch umso dankbarer für all die Arbeit derer, die uns alle schützen und für unser Wohlergehen sorgen. Diese Zeit der Ruhe und Rückbesinnung auf meine Familie ist zeitgleich eine Zeit der Sorge und Existenzangst für so viele andere. Auch ich kann mich den Wünschen meiner Kinder, dass alles gut werden wird, nur anschließen.
Britta Schiffmann, langjähriges Mitglied im Team na dann ...